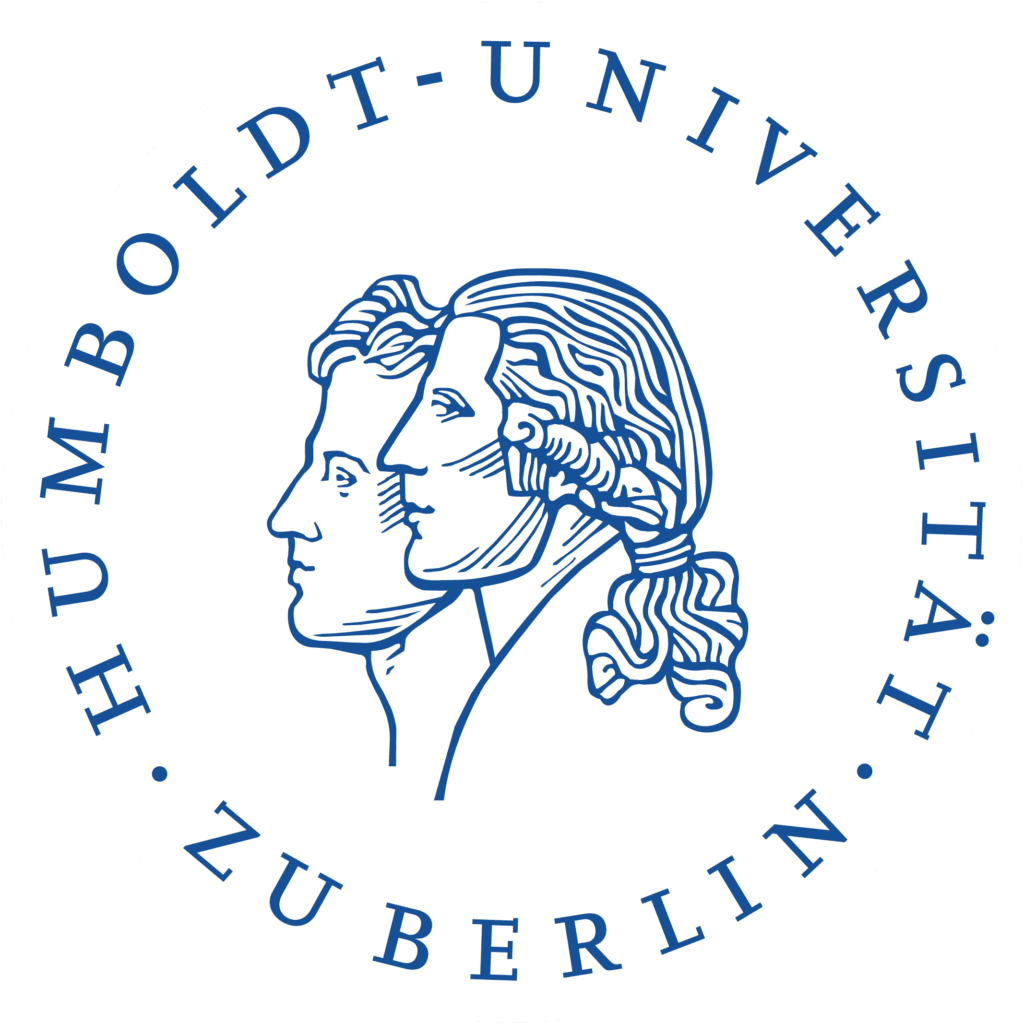Der Prozess
* vgl. Jeßberger, Florian/ Schuchmann, Inga: Der Stammheim-Prozess, in: Groenewold/ Ignor / Koch (Hrsg.), Lexikon der Politischen Strafprozesse, http://www.lexikon-der-politischen-strafprozesse.de/glossar/baader-andreas-und-ulrike-meinhof-gudrun-ensslin-holger-meins-jan-carl-raspe/
Verlauf und Bedeutung
Verlauf
Die Hauptverhandlung im Stammheim-Prozess fand in den Jahren 1975 bis 1977 vor dem 2. Strafsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart statt. Vor Gericht standen die Protagonisten der Ersten Generation der Rote Armee Fraktion (RAF), Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe.
Am 28. April 1977 wurden Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Ulrike Meinhof war ein Jahr nach Prozessbeginn, am 9. Mai 1976, erhängt in ihrer Zelle aufgefunden worden. Der ursprünglich ebenfalls mitbeschuldigte Holger Meins war bereits vor Eröffnung des Hauptverfahrens trotz Zwangsernährung an den Folgen eines Hungerstreiks gestorben. Eröffnet wurde die Hauptverhandlung am 21. Mai 1975. Angesichts langwieriger Auseinandersetzungen über die - nach Auffassung der Verteidigung durch die Haftbedingungen allenfalls eingeschränkte - Verhandlungsfähigkeit der Angeklagten konnte erst am 26. Verhandlungstag, dem 19. August 1975, mit der Verlesung der Anklageschrift und der Vernehmung zur Person begonnen werden. Am 39. Verhandlungstag, dem 23. September 1975, lagen dem Gericht schließlich Gutachten vor, aus denen hervorging, dass die Angeklagten tatsächlich nur zeitlich beschränkt verhandlungsfähig waren (S. 3112 des Protokolls der Hauptverhandlung). Der Senat beschloss daraufhin unter Protest der Verteidigung, die Verhandlung in Abwesenheit der Angeklagten fortzusetzen.
Auch der weitere Prozessverlauf war geprägt von Konflikten zwischen Verteidigung und Gericht. Am 174. Verhandlungstag, dem 20. Januar 1977, hatte der 85. Befangenheitsantrag gegen den Senatsvorsitzenden Erfolg, weshalb Dr. Prinzing aus dem Verfahren ausschied. Der Senat, dem nunmehr der Richter am Oberlandesgericht Dr. Foth vorsaß, stützte sich in seinem Beschluss auf außergerichtliche Äußerungen Prinzings gegenüber dem Verteidiger Künzel. Dr. Prinzing soll über Anträge des Verteidigers Schily gesagt haben: „Das ist doch der Frau Enss-lin egal, das kommt doch alles von Rechtsanwalt Schily.“ Aus Sicht der Angeklagten, so der Senat, sei daher die „Befürchtung nicht unbegründet, Dr. Prinzing messe aufgrund eines solchen ungeprüften Vorganges derartigen Anträgen eine geringere Bedeutung bei, als ihnen sonst zukäme“ (OLG Stuttgart, Beschluss vom 20.01.1977, S. 2, Anlage zum Protokoll der Hauptverhandlung, S. 13261 f.).
Kurz vor Ende der Hauptverhandlung, am 17. März 1977 (185. Verhandlungstag), wurde bekannt, dass vertrauliche Gespräche zwischen Verteidigern und den inhaftierten Angehörigen der RAF durch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg abgehört worden waren. Gerechtfertigt wurde dies durch die Landesregierung mit einem angeblichen Notstand nach § 34 StGB. Es sei zu befürchten gewesen, dass die Inhaftierten an der Planung weiterer erheblicher Straftaten gegen Leib und Leben andere Personen beteiligt gewesen seien, die anders nicht hätten verhindert werden können (S. 13738 f. des Protokolls der Hauptverhandlung). Nach Bekanntwerden dieses Vorgangs nahmen die Vertrauensanwälte nicht mehr an der Hauptverhandlung teil. Rechtsanwalt Schily erklärte:
„Was hier stattfindet in diesem Verfahren, das kann man nicht anders benennen als die systematische Zerstörung aller rechtsstaatlichen Garantien (…). Die Verteidigung kann es unter keinen Umständen verantworten, hier auch nur eine Minute länger in dem Verfahren mitzuwirken, um hier noch vielleicht als eine Art Alibi aufzutreten, daß es noch so etwas gebe wie eine Verteidigung“ (S. 13712 f. des Protokolls der Hauptverhandlung).
Der Strafsenat untersagte mittels haftrichterlicher Anordnung das weitere Abhören. Die von der Verteidigung beantragte Aussetzung der Hauptverhandlung bis die Vertraulichkeit der Verteidigergespräche sicher gewährleistet werden könne, lehnte das Gericht ab.
Einen Tag vor Verkündung des Urteils hielten die Verteidiger Schily, Dr. Heldmann, Oberwinder und Weidenhammer eine Pressekonferenz in einem Stuttgarter Hotel ab, wo sie öffentlich ihre Plädoyers vortrugen. Heldmann betonte, das Verfahren sei aus seiner Sicht „von Anfang an rechtsbrüchig“ gewesen (Heldmann, KJ 1977, 193), etwa angesichts der „Vorverurteilung als innerstaatliche Feinderklärung“, der auf den Stammheim-Prozess zugeschnittenen Gesetzesänderungen, der Mitwirkung befangener Richter, der Verhandlung trotz Verhandlungsunfähigkeit bzw. in Abwesenheit der Angeklagten sowie diverser „Beweisvereitelungsmethoden“. Schily kritisierte den Versuch staatlicher Akteure, die politische Dimension des Verfahrens zu unterdrücken (Die Welt, 28.4.1977), und bezeichnete den Prozess als Bestandteil der „psychologischen antisubversiven Kriegsführung“. Die Taten der Angeklagten seien „Widerstandsaktionen gegen den Völkermord von Vietnam“. Da es sich um politische Delikte handele, könne man ihnen die verbrecherische Politik entgegenstellen, gegen die sie sich wenden (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.4.1977). Auch die meisten der (Pflicht-) Verteidiger, die im Gerichtssaal plädierten, verlangten die Einstellung des Verfahrens aufgrund von Verfahrenshindernissen. Rechtsanwalt Schwarz, der Baader (gegen dessen Willen) als Pflichtverteidiger beigeordnet war, verwies zur Begründung auf die Mitwirkung eines offensichtlich befangenen Richters (Richter am Bundesgerichtshof Mayer, dazu unter 5.), auf die unzureichende gerichtliche Prüfung der Voraussetzungen einer Verhandlung in Abwesenheit der Angeklagten während der gesamten Dauer ihres Ausschlusses und auf das Abhören der Verteidigergespräche.
Am 192. Verhandlungstag wurde schließlich das Urteil verkündet. Alle drei verbliebenen Angeklagten wurden zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Gegen das Urteil legte die Verteidigung Revision ein. Noch bevor über die Revision entschieden werden konnte, nahmen sich die Angeklagten in der Nacht des 18. Oktober 1977 das Leben. Mit Eintreten dieses dauerhaften Prozesshindernisses fand der Prozess sein Ende; in Rechtskraft erwuchs das Urteil nie.
Bedeutung
Der Stammheim-Prozess zählt zu den großen politischen Strafprozessen des 20. Jahrhunderts. Der Ortsname „Stammheim“ - ein Stuttgarter Stadtteil, in welchem das Gerichtsgebäude eigens für den Prozess errichtet worden war - steht seither emblematisch für das Bemühen des Staates, politisch motivierter (terroristischer) Gewalt mit den Mitteln des Strafrechts zu begegnen.
Der Prozess war einer der längsten und aufwendigsten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die Anklageschrift benannte fast eintausend Zeugen, eintausend Polizeiberichte und 40.000 Beweismittel wurden eingereicht. Die Bedeutung des Prozesses spiegelt sich aber nicht nur in den zahlreichen logistisch-organisatorischen Vorbereitungen wider, sondern auch in einer beispiellosen Reihe juristischer Maßnahmen, die im Blick auf den bevorstehenden Mammutprozess getroffen worden waren. Waren in der Kleinen Strafrechtsreform von 1964 die Rechte des Angeklagten noch erweitert worden, ging es nun um Anderes: Unmittelbar vor und während des Prozesses wurden drei, unmittelbar im Anschluss zwei weitere Gesetze zur Änderung des Straf- und Strafprozessrechts verabschiedet, welche die Rechte des Angeklagten und der Verteidigung spürbar beschnitten.
Das erste Strafverfahrensreformgesetz vom 9. Dezember 1974 sowie das Erste Ergänzungsgesetz hierzu vom 20. Dezember 1974 sahen u.a. die Möglichkeit des Verteidigerausschlusses (§ 138a StPO), die Beschränkung der Anzahl der Wahlverteidiger auf drei je Beschuldigtem (§ 137 I S. 2 StPO), das Verbot der Mehrfachverteidigung (§ 146 StPO), sowie die Möglichkeit vor, den Prozess im Falle selbstverschuldeter Verhandlungsunfähigkeit auch in Abwesenheit des Angeklagten durchzuführen. Mit dem Anti-Terror-Gesetz vom 18. August 1976 wurden die Folgen des Verteidigerausschlusses verschärft und die Überwachung des Schriftverkehrs zwischen Inhaftierten und Verteidigern ermöglicht. Zudem wurde der Straftatbestand der Bildung terroristischer Vereinigungen (§ 129a StGB) geschaffen, der freilich, anders als die strafprozessualen Neuregelungen, im Stammheim-Prozess nicht zur Anwendung kommen konnte. Das Kontaktsperregesetz vom 30. September 1977, das bereits am 2. Oktober 1977 in Kraft trat, schaffte nachträglich eine gesetzliche Grundlage für die schon während der Schleyer-Entführung angeordnete Kontaktsperre zwischen Verteidigern und Inhaftierten.
Das Razziengesetz vom 14. April 1978 setzte die für den Verteidigerausschluss erforderliche Verdachtsschwelle herab, erschwerte die Kommunikation zwischen Inhaftierten und Verteidigern durch das Einführen einer Trennscheibe in den Fällen des § 129a StGB und schuf eine gesetzliche Grundlage für die Errichtung von Kontrollstellen, an denen verdachtsunabhängige Identitätskontrollen durchgeführt werden können (§ 111 StPO). Durch das Sechste Strafverfahrensänderungsgesetz vom 8. Juni 1978 wurde die Ablehnung eines Richters erschwert, was als Reaktion auf die zahlreichen Befangenheitsanträge gegen den Vorsitzenden Richter im Stammheim-Prozess angesehen werden kann, eine Rügepräklusion bzgl. der Besetzung des Gerichts eingeführt (§ 222b StPO), und die Beschwerdemöglichkeit gegen Verfügungen des Ermittlungsrichters am Bundesgerichtshof eingeschränkt. Mit Neufassung des § 245 StPO wurde zudem das Recht der Verteidigung, die Verwertung präsenter Beweismittel zu erzwingen, abgeschafft.
Beteiligte
Die Beschuldigten
Andreas Bernd Baader, geboren am 6. Mai 1943 in München, wuchs als Halbwaise bei seiner Mutter in München auf. Schon in der Schulzeit fiel er durch aggressives Verhalten auf. Nach Abschluss der mittleren Reife 1961 an einer Münchner Privatschule zog er Mitte der 1960er Jahre nach Berlin. Dort lebte er mit einer Malerin zusammen, mit der er 1965 eine gemeinsame Tochter bekam. Er kam zwar mit der Studentenbewegung und der Außerparlamentarischen Opposition (APO) in Kontakt und hatte auch gelegentliche Verbindungen zur Kommune 1, blieb jedoch bei politischen Diskussionen eher eine Randfigur. Anfang 1968 lernte er Gudrun Ensslin kennen. Bis dahin war er nur durch Delikte wie das Fahren ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich in Erscheinung getreten war, nun beteiligte er sich zusammen mit Ensslin an der später sog. Frankfurter Kaufhausbrandstiftung, wofür er zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt wurde (dazu unter 3). Baader tauchte unter, wurde 1970 erneut verhaftet, kurze Zeit später befreit und schließlich im Juni 1972 aufgrund der Taten im Rahmen der sog. „Mai-Offensive“ (dazu unter 3.) festgenommen. Im November 1974 wurde er nach Stammheim verlegt.
Gudrun Ensslin wurde am 15. August 1940 in Bartholomä (Kreis Schwäbisch Gmünd) geboren. Sie wuchs mit sechs Geschwistern in einer Pfarrerfamilie auf. Nach dem Abitur 1960 in Stuttgart studierte sie bis 1963 Germanistik in Tübingen, brach das Studium jedoch ab und wechselte an die Pädagogische Hochschule in Schwäbisch Gmünd, an der sie bereits 1964 die erste Dienstprüfung für das Lehramt an Volksschulen ablegte. Mit ihrem Lebensgefährten Bernward Vesper zog sie anschließend nach West-Berlin, wo sie sich - gefördert durch ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes - an der Freien Universität zur Promotion einschrieb. Nachdem sie sich 1965 politisch für die SPD eingesetzt und in dem von Günter Grass zur Unterstützung des Wahlkampfes von Willy Brandt gegründeten „Wahlkontor deutscher Schriftsteller“ mitgearbeitet hatte, distanzierte sie sich nach dem Zustandekommen der Großen Koalition von der Partei. 1967 bekamen Ensslin und Vesper einen Sohn. Ensslin engagierte sich zunehmend politisch und nahm an Demonstrationen und Aktionen des SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund) teil. Sie lernte Andreas Baader kennen und trennte sich von Vesper. Wegen ihrer Beteiligung an der Kaufhausbrandstiftung in Frankfurt wurde Ensslin, wie Baader, zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Zusammen mit Baader tauchte sie unter und entzog sich der Haft. Im Juni 1972 wurde sie in Hamburg festgenommen und im April 1974 von der JVA Essen nach Stammheim verlegt.
Ulrike Marie Meinhof, geboren am 7. Oktober 1934 in Oldenburg, wuchs in Jena auf. Ihr Vater starb bereits im Jahr 1940 und ihre Mutter lernte die in Jena studierende Renate Riemeck kennen. 1946 zogen sie mit ihren Kindern nach Oldenburg. Nach dem Tod von Meinhofs Mutter im März 1949 übernahm Renate Riemeck, die spätere Mitbegründerin der Deutschen Friedensunion, die Vormundschaft. Meinhof studierte als Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes in Marburg, ab 1957 in Münster, Pädagogik und Psychologie, sowie im Nebenfach Germanistik, zwischenzeitlich Geschichte und später Kunstgeschichte. Sie war politisch aktiv und nahm an den Versammlungen der SDS und der Evangelischen Studentengemeinde teil; sie engagierte sich im neu entstandenen Studentischen Arbeitskreis für ein kernwaffenfreies Deutschland und wurde journalistisch tätigt. Zusammen mit Jürgen Seifert brachte sie die Flugblattserie „argumente“ heraus. Zwischen 1959 und 1969 verfasste sie, als Promovendin an der Universität Hamburg, über einhundert Kolumnen für die Zeitschrift „konkret“, für die sie von 1961 bis 1963 auch als Chefredakteurin tätig war. Durch die Kolumnen erlangte sie bundesweite Bekanntheit. Von 1961 bis 1968 war sie mit dem Herausgeber der „konkret“, Klaus Rainer Röhl, verheiratet und bekam Zwillinge. 1968 und 1969 verfolgte Meinhof, inzwischen wohnhaft in West-Berlin, als „konkret“-Kolumnistin das Verfahren gegen Baader und Ensslin wegen der Frankfurter Kaufhausbrandstiftung. Als Baader und Ensslin auf der Flucht waren, nahm Meinhof die beiden bei sich auf. Nachdem Baader nur wenige Wochen später erneut verhaftet worden war, entwarf Meinhof den Plan für seine Befreiung. Angesichts ihrer Mitwirkung bei der Befreiungsaktion wurde sie wegen Beteiligung an einem Mordversuch polizeilich gesucht und lebte von nun an im Untergrund. Im Juni 1972 wurde sie in Hannover verhaftet und zunächst in Köln-Ossendorf in Untersuchungshaft untergebracht, bevor sie 1974 nach Stammheim verlegt wurde.
Holger Klaus Meins, geboren am 26. Oktober 1941 in Hamburg, begann 1962 ein Studium an der Hochschule für bildende Künste Hamburg, das er vier Jahre später abbrach, um zur neu gegründeten Deutschen Film- und Fernsehakademie nach Berlin zu wechseln. Er arbeitete dort als Darsteller und Kameramann an verschiedenen Filmen mit und drehte eigene Werke, unter anderem den dreiminütigen Dokumentarfilm "Wie baue ich einen Molotow-Cocktail?". Im September 1969 zog er in die Kommune 1. 1970 schloss er sich der RAF an. Zusammen mit Baader und Raspe wurde er am 1. Juni 1972 in Frankfurt am Main verhaftet. Meins, der als Beschuldigter im Verfahren gegen Baader u.a. geführt wurde, starb am 9. November 1974 an den Folgen eines Hungerstreiks in der Justizvollzugsanstalt Wittlich. Zur Eröffnung des Hauptverfahrens gegen ihn kam es nicht mehr.
Jan-Carl Raspe, geboren am 24. Juli 1944 in Seefeld/Tirol, wuchs in Ostberlin auf. Noch vor dem Bau der Mauer zog er zu Verwandten nach West-Berlin. Er machte das Abitur und immatrikulierte sich anschließend an der Freien Universität. Nach zwei Semestern des Studiums der Chemie schrieb er sich für Soziologie ein. Raspe beteiligte sich aktiv an den Studentenprotesten der späten 1960er und lebte eine Weile in der Kommune 2. Im Herbst 1970 schloss er sich der RAF an. Am 1. Juni 1972 wurde er zusammen mit Baader und Meins in Frankfurt am Main festgenommen. Er wurde, wie die anderen Angeklagten, 1974 nach Stammheim verlegt.
Das Gericht
Die Hauptverhandlung fand vor dem 2. Strafsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart statt, dem der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht Dr. Theodor Prinzing vorsaß. Beisitzer waren die Richter am Oberlandesgericht Dr. Eberhard Foth, Hubert Maier, Dr. Ulrich Berroth und Dr. Kurt Breucker. Als Ergänzungsrichter nahmen die Richter am Oberlandesgericht Otto Vötsch, Heinz Nerlich, Werner Meinhold und Hans-Jürgen Freuer am Prozess teil. Dr. Prinzing wurde gegen Ende des Verfahrens wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt und Dr. Foth übernahm den Vorsitz. Der Richter am Oberlandesgericht Vötsch rückte als Beisitzer nach.
Die Verteidiger
Im Laufe des Verfahrens war eine Vielzahl von Verteidigerinnen und Verteidigern am Verfahren beteiligt. Ursprünglich wurden die Rechtsanwältin Marieluise Becker (Heidelberg) sowie die Rechtsanwälte Dr. Klaus Croissant (Stuttgart), Kurt Groenewold (Hamburg), Helmut Riedel (Frankfurt a.M.), Otto Schily (Berlin), Christian Ströbele (Berlin) und Rupert von Plottnitz (Frankfurt a.M.) gemeinschaftlich den Beschuldigten als Pflichtverteidiger beigeordnet. Mit der Einführung des Verbots der Mehrfachverteidigung wurde eine neue Zuordnung erforderlich: Die Rechtsanwälte Dr. Croissant, Groenewold und Ströbele wurden nunmehr Baader, Rechtsanwältin Becker und Rechtsanwalt Schily Ensslin, Rechtsanwalt Riedel Meinhof sowie Rechtsanwalt von Plottnitz Raspe beigeordnet.
Gegen den erklärten Willen der Angeklagten wurden ihnen durch das Gericht je zwei weitere Pflichtverteidiger beigeordnet: Für Baader waren dies die Rechtsanwälte Dieter Schnabel (Ditzingen) und Eberhard Schwarz (Stuttgart), für Ensslin die Rechtsanwälte Ernst Eggler (Karlsruhe) und Manfred Künzel (Waiblingen), für Meinhof die Rechtsanwälte Dieter König (Stuttgart) und Karl-Heinz Linke (Karlsruhe) und für Raspe die Rechtsanwälte Peter Grigat (Stuttgart) und Stefan Schlaegel (Esslingen).
Noch vor Beginn der Hauptverhandlung waren Croissant, Groenewold und Ströbele auf Grundlage einer gerade in Kraft getretenen gesetzlichen Regelung von der weiteren Mitwirkung im Verfahren ausgeschlossen worden. Für Baader ergab sich daraus die schwierige Situation, zu Beginn des Hauptverfahrens keinen Verteidiger seines Vertrauens an seiner Seite zu haben. Die ihm gegen seinen Willen beigeordneten Pflichtverteidiger lehnte er ab. Erst am 4. Verhandlungstag stand ihm mit Dr. Hans Heinz Heldmann (Darmstadt) wieder ein Verteidiger seines Vertrauens zur Verfügung. Der Antrag Dr. Heldmanns auf zehntägige Verhandlungsunterbrechung zur Einarbeitung in die (mehr als 150 Ordner umfassende) Prozessakte wurde u.a. mit der Begründung abgelehnt, Baader habe die Ausschlüsse seiner Verteidiger absehen können, sich aber frei entschieden, für diesen Fall keine Vorkehrungen zu treffen (S. 292 ff. des Protokolls der Hauptverhandlung). Zu Beginn der Hauptverhandlung wurde auch Rechtsanwalt Siegfried Haag (Heidelberg) noch als Pflichtverteidiger Baaders geführt. Haag tauchte jedoch zehn Tage vor Verhandlungsbeginn unter und schloss sich der RAF an.
Im Laufe des Verfahrens fanden zahlreiche Verteidigerwechsel statt. Fast alle Pflichtverteidiger wurden nach einiger Zeit wieder entpflichtet (Becker, Riedel, von Plottnitz, zuletzt kurz vor Ende der Hauptverhandlung auch Heldmann), nahmen z.T. aber als Wahlverteidiger weiter am Prozess teil.
Hinzu kamen noch weitere Wahlverteidiger, die jedoch nicht gleichermaßen am Prozess teilnahmen wie die genannten Wahlpflichtverteidigerinnen und -verteidiger. Zu nennen sind hier insbesondere Prof. Dr. Axel Azzola (Darmstadt) sowie die Rechtsanwälte Armin Golzem (Frankfurt a.M.), Dr. Dieter Hoffmann (Berlin), Rainer Köncke (Hamburg), Frank Kopp (Frankfurt a.M.), Wilfred Mairgünther (Kiel), Arndt Müller (Stuttgart), Michael Oberwinder (Frankfurt a.M.), Victor Pfaff (Darmstadt), Henning Spangenberg (Berlin), Dr. Gerd Temming (Frankfurt a.M.) und Karl-Heinz Weidenhammer (Frankfurt a.M.).
Die Staatsanwaltschaft
Die Anklage wurde durch den Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof vertreten. Als Vertreter der Bundesanwaltschaft traten Bundesanwalt Dr. Heinrich Wunder, Oberstaatsanwalt Peter Zeis, Regierungsdirektor Werner Widera sowie Oberstaatsanwalt Klaus Holland auf.
Zeitgeschichtliche Einordnung
Die Entstehung der RAF und damit auch der Stammheim-Prozess fügt sich in eine Entwicklung, die in den 1960er Jahren begonnen hatte. Bereits damals hatten u.a. die geplanten Notstandsgesetze dazu geführt, dass sich eine Protestbewegung aus Studierenden, Hochschullehrerinnen und -lehrern und Intellektuellen gebildet hatte. Ab 1966/67 richtete sich der Protest zunehmend gegen den Vietnam-Krieg. Innerhalb der Bewegung entwickelte der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) sich zu einer einflussreichen Gruppierung. Da die 1966 gebildete Große Koalition aus SPD und CDU/CSU einer nahezu machtlosen Opposition (FDP) gegenüberstand, rief der Vorsitzende des SDS, Rudi Dutschke, alle Bewegungen, die sich politisch links von der SPD befanden, zur Gründung einer Außerparlamentarischen Opposition (APO) auf. In der Folge kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Die Presse, allen voran der Springerkonzern, heizte die Stimmung weiter an. Am 2. Juni 1967 erreichte die Polizeigewalt bei einer Demonstration in Berlin gegen den Besuch des Schahs von Persien mit der Erschießung des 26jährigen Studenten Benno Ohnesorg durch einen Polizeibeamten einen Höhepunkt.
Auch auf Seiten der APO wurde zunehmend die Anwendung von „Gegengewalt“ als Option erwogen. In der Nacht des 3. April 1968 legten Gudrun Ensslin, Andreas Baader, Horst Söhnlein und Thorwald Proll in zwei großen Frankfurter Kaufhäusern Feuer. Diese Aktion fand nicht überall Unterstützung. Ulrike Meinhof, Beobachterin im anschließenden Strafprozess, interpretierte die Brandstiftung in ihrer „konkret“-Kolumne als „Angriff auf die kapitalistische Konsumwelt“ und konstatierte, dass die Konsumwelt durch diesen Warenhausbrand nicht einmal verletzt worden sei. Zudem spreche gegen Brandstiftung im Allgemeinen, dass hierbei „Personen gefährdet sein könnten, die nicht gefährdet sein sollen.“ Ensslin hingegen erklärte im Prozess, sie und Baader hätten aus Protest gegen die Gleichgültigkeit gehandelt, mit der die Menschen dem Völkermord in Vietnam zusähen. Sie hätten nur Sachen beschädigen, aber niemanden gefährden wollen. Ensslin, Baader, Söhnlein und Proll wurden zu Freiheitsstrafen von je drei Jahren verurteilt. Nach 14 Monaten wurde ihnen zunächst Haftverschonung gewährt. Ihre Revision wurde im November 1969 vom Bundesgerichtshof abgewiesen, so dass auch die Reststrafe von 22 Monaten zu vollstrecken war. Baader und Ensslin setzten sich daraufhin zunächst nach Paris und Rom, später nach Westberlin ab, um sich der Haft zu entziehen.
Im April 1970 wurde Baader erneut verhaftet. Im Verlauf der bewaffneten Befreiungsaktion, bereits einen Monat später, an der unter anderem Ulrike Meinhof beteiligt war, wurden mehrere Personen verletzt, eine davon lebensgefährlich. Die Befreiung Baaders aus der Haft am 14. Mai 1970 gilt als Geburtsstunde der RAF. Nicht nur Baader und Ensslin, sondern auch Meinhof, die nun wegen der Beteiligung an einem versuchten Mord gesucht wurde, lebten von nun an im Untergrund. Nachdem Baader, Ensslin und Meinhof sich im Juni 1970 in Jordanien in einem palästinensischen Ausbildungslager in den Techniken des Guerillakampfes hatten unterweisen lassen, trat die Gruppe ab September 1970 mit Banküberfällen, Autodiebstählen und Einbrüchen in Rathäuser und Meldeämter zur Beschaffung von Pässen und weiteren Papieren in Erscheinung. Im April 1971 veröffentlichte die nun als Rote Armee Fraktion auftretende Gruppe die Schrift „Das Konzept Stadtguerilla“, in der die Notwendigkeit der Organisation des bewaffneten Widerstands aus theoretischer und ideologischer Sicht dargelegt wurde. Die RAF selbst sah sich als Teil einer „revolutionären Weltarmee“, die gegen die Gesellschaft der jungen Bundesrepublik, welche als Fortsetzung des nationalsozialistischen Deutschlands begriffen wurde, gegen das kapitalistisch-imperialistische System, gegen die USA und den `Krieg in Vietnam kämpfte.
Im Mai 1972 verübte die RAF mehrere Anschläge („Mai-Offensive“), bei denen insgesamt vier Personen getötet und dutzende weitere verletzt wurden. Am 11. Mai explodierten drei Sprengkörper im ehemaligen IG-Farben-Haus in Frankfurt a.M., in dem das Hauptquartier des fünften US-Corps seinen Sitz hatte („Kommando Petra Schelm“). Dabei kam eine Person ums Leben, weitere Personen wurden verletzt. Am 12. Mai detonierten drei Sprengkörper in der Polizeidirektion Augsburg und einer auf dem Parkplatz des Bayerischen Landeskriminalamtes in München („Kommando Thomas Weisbecker“). Mehrere Personen wurden verletzt, es entstand erheblicher Sachschaden. Am 15. Mai explodierte ein Sprengsatz in Karlsruhe, der unter dem Beifahrersitz des Fahrzeugs von Bundesrichter Buddenberg deponiert worden war („Kommando Manfred Grashof“). Dessen Ehefrau, die sich zum Zeitpunkt der Explosion allein im Fahrzeug befunden hatte, erlitt erhebliche Verletzungen. Am 19. Mai explodierten zwei Sprengsätze in der Zentrale des Springer-Verlages in Hamburg („Kommando 2. Juni“), wobei mehrere Personen in dem vollbesetzten Verlagshaus zum Teil schwer verletzt wurden. Bei einer Begehung des Gebäudes wurden drei weitere Sprengsätze gefunden, die nicht detoniert waren. Am 24. Mai explodierten zwei Kraftfahrzeuge auf dem Gelände des Hauptquartieres der siebten US-Armee und der US-Landstreitkräfte in Europa (USAREUR) in Heidel-berg („Kommando 15. Juli“), drei amerikanische Soldaten kamen ums Leben, weitere Personen gerieten in Lebensgefahr oder wurden verletzt.
Nach der Eskalation der Gewalt im Rahmen der „Mai-Offensive“ wurde die Fahndung nach den Tätern mit erheblichem Aufwand betrieben. Baader, Meins und Raspe konnten so bereits am 2. Juni, Ensslin am 7. Juni und Meinhof am 15. Juni 1972 festgenommen werden.
Von nun an wurde die Befreiung von Baader, Ensslin, Meinhof, Meins und Raspe sowie weiterer inhaftierter RAF-Mitglieder zu einem zentralen Anliegen der sog. Zweiten Generation der RAF. Mit dem „Deutschen Herbst“ erreichten diese Bemühungen 1977 eine weitere, neue Eskalationsstufe. Sie gipfelten in der Entführung des Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) Hanns Martin Schleyer. Hierdurch sollten elf Gefangene der RAF freigepresst werden, darunter auch die Angeklagten im Stammheim-Prozess. Mit dem Tod der in Stammheim inhaftierten RAF-Mitglieder in der Nacht des 18. Oktober 1977 war diese Forderung gegenstandslos geworden. Am 19. Oktober 1977 wurde Hanns Martin Schleyer erschossen im Kofferraum eines PKW aufgefunden.
Die Anklage
Der Anklagevorwurf gegen alle Angeklagten lautete Mord, versuchter Mord, Bildung bzw. Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen sowie schwerer Raub, davon in einem Fall mit Todesfolge, und Verabredung zum Raub. Hinzu kam der Vorwurf schweren Diebstahls gegenüber Baader, Ensslin und Meinhof sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen Baader, Ensslin und Raspe.
Die vorgeworfenen Taten waren in vier Tatkomplexe unterteilt. Der erste Komplex bezog sich auf die sechs Sprengstoffanschläge, die in der Zeit vom 11. bis 24. Mai 1972 verübt worden waren („Mai-Offensive“); den Angeklagten wurde die mittäterschaftliche Begehung von insgesamt vier Morden, 54 versuchten Morden sowie tateinheitlich hierzu jeweils die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen. Den zweiten angeklagten Tatkomplex bildeten diverse Raub- und Diebstahlsdelikte zwischen September 1970 und Januar 1972. Der dritte Komplex betraf Straftaten im Zusammenhang mit der Festnahme der Angeklagten. Hier wurde den Angeklagten Baader, Ensslin und Raspe, die versucht hatten, sich durch den (im Falle Ensslins: verhinderten) Einsatz von Schusswaffen der Festnahme zu entziehen, versuchter Mord an den Polizeibeamten in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Schließlich wurden die Angeklagten wegen der Gründung und Beteiligung als Rädelsführer (Baader, Ensslin, Meinhof) bzw. der Beteiligung als Mitglied (Raspe) an einer kriminellen Vereinigung angeklagt.
Die Verteidigung
Die Verteidigung war in jeder Hinsicht konfliktreich, dies in erster Linie im Verhältnis zu den Vertretern der Anklage und dem Gericht, aber auch im Verhältnis der Angeklagten zu einem Teil ihrer Verteidiger. Die Angeklagten unterschieden strikt zwischen den von ihnen so bezeichneten „Zwangsverteidigern“, also den vom Gericht gegen ihren Willen bestellten Pflichtverteidigern, auf der einen und den von ihnen selbst ausgewählten „Vertrauensanwälten“ auf der anderen Seite. Nicht alle der „Vertrauensanwälte“ waren Wahlverteidiger i.e.S.; einige (Becker, Dr. Heldmann, von Plottnitz, Riedel, Schily) wurden den Angeklagten vom Gericht als Pflichtverteidiger beigeordnet.
Im Verlauf der Hauptverhandlung traten die vom Gericht gegen den Willen der Angeklagten bestellten Pflichtverteidiger kaum in Erscheinung. Eine Absprache mit den Mandantinnen und Mandanten war ihnen nicht möglich, da die Mandanten es ablehnten, mit ihnen zu sprechen. Erst im Zusammenhang mit den Geschehnissen, die der Ablehnung Dr. Prinzings vorausgingen, brachte sich insbesondere Rechtsanwalt Künzel aktiver in den Prozess ein. Bemerkenswert dabei ist die Entwicklung seines Verhältnisses zum Senat einerseits und zu den „Vertrauensanwälten“, insbesondere zu Schily, andererseits. Künzel, der einen Teil seiner Referendarsausbildung bei Dr. Prinzing absolviert hatte, musste sich seiner eigenen Schilderung nach „dazu durchringen“, den ersten Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden zu stellen (S. 13175 des Protokolls der Hauptverhandlung). Nachdem dieser und ein ebenfalls von Künzel gestellter weiterer Befangenheitsantrag abgewiesen worden waren, suchte Dr. Prinzing das Gespräch mit Künzel. Den Inhalt dieses Gesprächs vertraute Künzel wiederum Schily an, dem er zu Beginn der Hauptverhandlung noch standeswidriges Verhalten vorgeworfen hatte. Schilys hierauf gestützter Ablehnungsantrag hatte schließlich Erfolg. Das Verhältnis der Vertrauensverteidigerinnen und -verteidiger zum Senat war von heftigen Auseinandersetzungen geprägt. Während sich erstere einer Reihe ehrengerichtlicher Verfahren ausgesetzt sahen, wurde der Senat mit Befangenheitsanträgen überhäuft. Die Konfliktsituation resultierte nicht zuletzt aus den unterschiedlichen Auffassungen über die Rolle der Verteidigung im Prozess. Der Senat betonte, die Verteidigung liege im öffentlichen Interesse und diene „nicht nur der Wahrung der Verteidigung des Angeklagten, sondern auch […] einem geordneten Verfahren“ (Protokoll der Hauptverhandlung, S. 3176). Die Verteidigung hingegen sah ihre Mandantschaft als Angeklagte in einem auch von staatlichen Willkürmaßnahmen geprägten politischen Strafprozess.
In prozessualer Hinsicht konzentrierte sich die Verteidigung vor allem auf drei Themenfelder: die Frage der Verhandlungsfähigkeit der Angeklagten, die Rechte der Verteidigung und die Frage der Befangenheit des Gerichts.
Den Blick des Gerichts auf die gesundheitliche Verfassung der Angeklagten und die Frage der Verhandlungsfähigkeit zu lenken, war insbesondere in den ersten 40 Verhandlungstagen das zentrale Anliegen der Verteidigung. Hier ging es zunächst darum zu erreichen, dass für die Angeklagten dieselben Haftbedingungen gelten sollten wie für andere, „gewöhnliche“ Untersuchungsgefangene. In einer späteren Phase des Prozesses wurden dann privilegierte Haftbedingungen gefordert, weil, wie insbesondere in einem Antrag Prof. Azzolas im Namen von Meinhof vorgetragen wurde, die Angeklagten als Kriegsgefangene im Sinne des humanitären Völkerrechts zu betrachten seien.
Im Fokus der Verteidigung standen, zweitens, diejenigen Umstände, die eine wirksame Verteidigung fraglich erscheinen ließen. Hierzu zählten etwa der Ausschluss der drei Hauptverteidiger (Croissant, Groenewold und Ströbele) kurz vor Prozessbeginn, aber auch die Vielzahl von Ehrengerichtsverfahren gegen die Verteidigung während des laufenden Verfahrens. So sah die Verteidigung sich fortlaufend dem Vorwurf der „Komplizenschaft“ ausgesetzt. Auch die vor und während des Prozesses in Kraft getretenen Gesetzesänderungen erschwerten die Verteidigung. Die Blockverteidigung der sich als politisches Kollektiv begreifenden Angeklagten war durch die Änderung der Strafprozessordnung und die Ausschließung einiger Verteidiger vor Prozessbeginn vereitelt worden. Trotz des Verbots der Mehrfachverteidigung war es den (Vertrauens-) Verteidigern nach wie vor möglich, ihr Handeln miteinander abzustimmen und so ein gemeinsames prozesstaktisches und -strategisches Vorgehen zu ermöglichen (Sockelverteidigung).
Ein drittes Thema der Verteidigung betraf schließlich die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der beteiligten Richter. Besonders brisant war der Umstand, dass Dr. Prinzing dem Richter am Bundesgerichtshof Mayer auf dessen Bitte Prozessunterlagen hatte zukommen lassen, welcher wiederum Informationen daraus an die Presse weitergab. Mayer war Mitglied des 3. Strafsenats des BGH, der Beschwerdeinstanz im Stammheim-Prozess. In dieser Funktion hatte Mayer an allen Beschwerdeentscheidungen im Verfahren mitgewirkt. Mayer wurde in der Folge durch das Präsidium des BGH vom 3. zum 4. Strafsenat versetzt.
Im Hinblick auf die vorgeworfenen Taten zielte die Verteidigung darauf, die politische Dimension der Taten in den Vordergrund zu stellen und ein Nothilferecht bzw. ein völkerrecht-lich begründetes Widerstandsrecht gegen die Akteure des Vietnam-Krieges zu reklamieren. Weil es den Streitkräften der USA ermöglicht worden sei, für die Begehung völkerrechtswidrige Aggressionsverbrechen (in Vietnam) auch deutsches Staatsgebiet zu nutzen, sei auch die BRD an diesen Kriegsverbrechen beteiligt. Sämtliche Beweisanträge der Verteidigung, die in diesem Zusammenhang standen, wurden durch den Senat abgewiesen.
Die Aktivitäten der Verteidigung beschränkten sich nicht auf den Gerichtssaal. Auch die Öffentlichkeitsarbeit in einem weit verstandenen Sinne bildete einen wichtigen Bestandteil der Verteidigung. Ein Beispiel ist der von Croissant organisierte Besuch des Schriftstellers Jean-Paul Sartre, der Baader am 4. Dezember 1974 in der Untersuchungshaft in Stammheim aufsuchte und auf einer anschließenden Pressekonferenz über seine Eindrücke berichtete. Auch während des Prozesses gab die Verteidigung zahlreiche öffentliche Stellungnahmen ab, in denen die Haftbedingungen kritisiert wurden. Auf Einladung von Anwalts- und Richtervereinigungen berichteten die Verteidiger auch im Ausland über die Einschränkung der Verteidigung und die Haftbedingungen.
Das Urteil
Mit Urteil vom 28. April 1977 wurden die Angeklagten Baader, Ensslin und Raspe wegen Mordes, des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Bildung einer kriminellen Vereinigung zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Die Verfolgung war auf die Taten im Zusammenhang mit den Sprengstoffanschlägen, mit der Festnahme der Angeklagten sowie auf den Vorwurf der kriminellen Vereinigung beschränkt worden (§ 154a StPO), sodass die Raub- und Diebstahlsdelikte nicht mehr Gegenstand des Urteils waren.
Auf mehr als 300 Seiten begründete der Senat seine Entscheidung. Auch in den Urteilsgründen wird das Bemühen des Gerichts deutlich, die politische Dimension des Verfahrens auszublenden. Nur elf Seiten betreffen die rechtliche Würdigung des festgestellten Sachverhalts. Die Ausführungen zu dem zentralen Argument der Verteidigung, die Angeklagten hätten in Ausübung eines völkerrechtlichen Widerstandsrechts im Blick auf die Geschehnisse in Vietnam gehandelt, beschränken sich auf die Feststellung, Anhaltspunkte zur Annahme eines entsprechenden Rechtfertigungs- oder Schuldausschließungsgrundes seien nicht erkennbar. Die Frage, ob die Angeklagten in einem Verbotsirrtum gehandelt hätten, wird auf etwa einer Seite erörtert (und verneint). Demgegenüber stehen 89 Seiten Feststellungen sowie 295 Seiten Beweiswürdigung. Wichtigster Zeuge, auf den sich das Urteil stützt, war das ehemalige RAF-Mitglied Gerhard Müller, der als Kronzeuge im Prozess ausgesagt hatte (S. 220 bis 266 des Urteils).
Wirkung und zeitgenössische Bewertung
Nicht nur in den Rechts- und Sozialwissenschaften fand der Prozess kritische Aufmerksamkeit. Auch in der allgemeinen Öffentlichkeit erfuhr er große Beachtung. Dabei war das Echo in den Medien zwiegespalten. Während die Verurteilung der Angeklagten überwiegend begrüßt wurde oder zumindest erwartet worden war, wurden der Prozess selbst und das Verhalten der Prozessbeteiligten zuweilen stark kritisiert. Die Badische Zeitung fasste den Prozess zusammen:
„Der Rest ist Unbehagen (…). Man (…) muß erwarten, daß der Stammheim-Prozeß ein zweites Mal aufgerollt wird. Zu sehr häuften sich Fehler und Mißstände, die diese Hauptverhandlung begleiteten (…) Verteidigung im rechtsstaatlichen Sinn war nicht möglich. Die feindselige und sabotierende Art der Angeklagten zwangen Justiz und Staat zu immer schärferen Reaktionen. Isolierhaft, Hauptverhandlung ohne die Angeklagten (…) Auch in Stil und Atmosphäre war dieser Prozeß schäbig bis unwürdig. Schließlich wurde das Urteil gesprochen, ohne daß ihm eine substantielle und fundierte Strafverteidigung (…) vorausgegangen ist. Da ein Strafurteil nie von der Form, wie es erreicht wurde, zu trennen ist (…), ist das Stammheim-Urteil ein Richterspruch minderer Qualität, auch wenn es (…) gerecht genannt werden kann“ (Badische Zeitung, 29.4.1977, S. 4, zit. n. Kühnert, in: Schultz (Hrsg.), Große Prozesse - Recht und Gerechtigkeit in der Geschichte, 414, 423).
Auch das Wochenmagazin Spiegel hob die negativen Auswirkungen der konfliktgeladenen Atmosphäre hervor:
„Selten genug rückte ins Blickfeld des Verfahrens, ob und was der Prozeß an neuen Erkenntnissen für oder gegen die Schuld der Angeklagten erbrachte - fast immer verdrängt von den grellen Effekten einer verbissen ausgetragenen Fehde, die die Fronten zwischen den Prozeßbeteiligten versteinerte, der Wahrheitsfindung nicht dienen konnte und sich am Ende nur noch darauf zuspitzte, wer die meisten Federn ließ“ (Spiegel, Nr. 19/1977, S. 36).
Zum Urteilsspruch selbst hieß es dort: „Das Urteil überraschte niemanden, allenfalls, daß es schließlich überhaupt noch erging.“ Wirkmächtig wurde der Stammheim-Prozess schließlich auch im Blick auf die RAF selbst. Der Umgang mit terroristischer Gewalt und die vielfach als überzogen empfundene Reaktion des Staates (und der Strafjustiz) wurden nun selbst zum Bezugspunkt terroristischer Aktion: Die Versuche der Freipressung von Gefangenen, die Mobilisierung von „Sympathisanten“ durch das Anprangern der Haftbedingungen („Isolationsfolter“) überlagerten seit Beginn des Stammheim-Prozesses das „Welt-Guerilla“-Narrativ der RAF.
Würdigung
Der Stammheim-Prozess bildet ein Schlüsselereignis der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte. Im Straf- und Strafprozessrecht hat der Prozess tiefe Spuren hinterlassen. Der überwiegende Teil der gesetzlichen Regelungen, die als „leges Stammheim“ vor, während oder als unmittelbare Reaktion auf den Prozess geschaffen wurden, sind heute noch in Kraft. Der Prozess markiert die Geburtsstunde des modernen Terrorismusstrafrechts in Deutschland. Erkennbar wurden erste Ansätze eines Präventions- oder Sicherheitsstrafrechts moderner Prägung (dazu etwa Paeffgen, FS Amelung 2009, 81 ff.; Sieber NStZ 2009, 353 ff.). Rückblickend lässt sich kaum bestreiten, dass der Stammheim-Prozess auch durch rechtsstaatlich übergriffige Elemente gekennzeichnet war. Hierzu wird man das Abhören der Verteidigergespräche und die vollständige Kontaktsperre (wiewohl vom BVerfG als verfassungsrechtlich zulässig beurteilt) zählen müssen.
Auch in anderer Hinsicht hat sich der Prozess als richtungsweisend im Blick auf den künftigen Umgang der Strafjustiz mit terroristischen Straftätern erwiesen. Ein wichtiges Element auch späterer Verfahren gegen Angehörige der RAF wurde etwa mit der sog. Kollektivitätsthese geschaffen (Gössner, 123 ff.). Damit konnte die strafrechtliche Haftung für alle von der Vereinigung begangenen und dieser zugerechneten Taten begründet werden, ohne den Nachweis eines konkreten Tatbeitrages führen zu müssen. In den Urteilsgründen stellt das Gericht fest, dass die Angeklagten „zugleich mit der Verabredung“ der Straftaten „die unerläßliche Verständigung darüber getroffen“ hätten, „daß die einzelnen Anschläge nach der Art der gewählten Objekte mit den allgemeinen Vorstellungen der Gruppe, dem ideologischen Konzept, das die ‚RAF’ verwirklichen wollte, vereinbar waren und von der Gruppe kollektiv getragen werden konnten.“ (Urteil, S. 298). Diese Annahme, von der Verteidigung als „Konstrukt“ zurückgewiesen, wurde als gerichtskundige Tatsache auch in weitere Prozesse gegen Angehörige der RAF eingeführt. Eine Zurechnung (unter dem Gesichtspunkt der Mittäterschaft) erfolgte auch, soweit die Angeklagten an den einzelnen Anschlägen nicht mitgewirkt und entsprechend den Geschehensablauf nicht beherrscht hatten. Ihr „enges Verhältnis zu den von ihnen verabredeten und organisierten Taten“ komme, so die Begründung des Gerichts, in dem „großen Interesse zum Ausdruck, das sie am Erfolg der Anschläge und den Zielen der ‚RAF’ hatten“ (Urteil, S.297).
Nach offizieller Lesart handelte es sich um einen „gewöhnlichen Straffall“, die Angeklagten waren „gewöhnliche“ Kriminelle, die wegen „gewöhnlicher“ Verbrechen angeklagt waren. Bei der Bemessung der Strafe immerhin berücksichtigte das Gericht, dass „es sich bei den Angeklagten um Täter handelt, die sich in den Vorstellungen ihrer politischen Wunschwelt versponnen haben“ (Urteil, S. 308). Bei den aus heutiger Sicht fast zwanghaft erscheinenden Bemühungen, die politische Dimension des Prozesses in Abrede zu stellen, mag auch eine Rolle gespielt haben, dass der Prozess in einem gesellschaftlichen Klima stattfand, in dem bis weit in bürgerliche Kreise hinein der RAF nicht nur politische Motive zugebilligt, sondern auch Verständnis für die Taten entgegengebracht wurde. Die Bundesanwaltschaft betrachtete das Verfahren jedenfalls als „exemplarischen Prozess“, in dem die Gründer und Anführer der RAF vor Gericht gestellt wurden. Von einer (in der Sache nicht fernliegenden) Anklage wegen Hochverrats (§ 81 StGB) war aber abgesehen worden. Eine solche Anklage hätte zur Folge gehabt, dass der politische Charakter der Tat unzweideutig hervorgetreten wäre. Rückblickend lässt sich feststellen, dass die Bemühungen um die „Entpolitisierung“ des Prozesses die Bedeutung und die Dimension des Verfahrens verkürzten. Der Stammheim-Prozess war alles andere als ein gewöhnliches Strafverfahren - nicht nur wegen der politischen Motivation der Angeklagten.